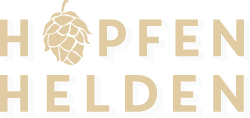Ein Kommentar von Markus Harms, Lebensmittel-Verarbeitungstechniker und Herausgeber des Infomagazins Bier & Brauhaus
Auch wenn der Markt noch so klein ist, fühlt sich doch jeder in wachsenden Branchen am wohlsten. Kein Wunder also kommt der deutschen Brauwirtschaft der Begriff „Craft Beer“ gerade recht. Seit Jahren muss sie Jahr um Jahr sinkende Bierabsatzzahlen verkünden und jetzt das: Ein Bier, das mit seinen tollen Wachstumszahlen in den USA doch auch hier ein potenzielles Zugpferd sein könnte. Die Craft-Beer-Bewegung ist in Sachen Kommunikation derzeit der rettende Strohhalm, an den sich deutsche Brauereien (auch die großen Gruppen) klammern, während die Gesamt-Absatzzahlen für den Gerstensaft sinken.
Bisher ist der Terminus „Craft Beer“ hierzulande aber noch nicht näher definiert und auch nicht geschützt. Deshalb sollten die Brauereien, besonders „die großen“, die das Thema Craft für sich besetzen möchten, den Ursprung der Bewegung in den USA beachten: die (nicht kommerziell ausgerichtete) Homebrewer-Szene. Aus kleinen Keimzellen entstanden je nach Motivation und Fähigkeiten mit der Zeit gewerbliche Betriebe.
Wir brauchen nicht mehr Marken – sondern mehr Geschmack
Ich habe den Eindruck, dass der Erfolg der großen Craft-Beer-Brauereien in USA die hiesigen Unternehmen dazu anspornt, es ihnen gleichzutun. Dieser Vorsatz kann unter Umständen aber schon ganz leicht daran scheitern, dass sich die Biermärkte und Brauereilandschaften in den USA und in Deutschland vollkommen unterschiedlich entwickeln und entwickelt haben. Auch die Konsumenten ticken mit Sicherheit ein wenig anders. Die Herausforderung lautet also in Deutschland nicht unbedingt, mehr Brauerei- bzw. Markenvielfalt zu schaffen, denn die hat der Verbraucher in seinen Augen bereits. Ziel sollte es doch wohl eher sein, eine echte, neue geschmackliche Vielfalt zu erzeugen und das riesige Potenzial, das uns die Bierzutaten bieten, auch zu nutzen bzw. nutzen zu wollen. Es geht darum, mutig zu sein.
Mit einem Streichholz kann man zwar einen Waldbrand auslösen. Aber im Vergleich dazu wärmt ein gemeinschaftliches Lagerfeuer doch irgendwie mehr und besser. Meines Erachtens stellen einige Brauereien (Braufactum, Ratsherrn, Craftwerk …) dem Verbraucher sinnbildlich eine Zentralheizung hin, ohne jedoch den Raum darum gebaut zu haben.
Per amerikanischer Definition wäre auch die Oettinger Brauerei, deren Bier ja zweifelsfrei sein Geld wert ist, eine Craft Brewery, wenn sie dies denn wollen würde. Aber in Deutschland geht das alles nicht so einfach, eine zweite „Burgerkettenrevolution“ brauchen wir nicht. Man muss schon die hiesigen gewachsenen Strukturen kennen und richtig einschätzen können, um dauerhaft eine erfolgreiche Bewegung loszutreten. Und letzten Endes entscheidet eh der Konsument, der mir auch hierzulande geschmacklich viel weiter zu sein scheint, als es uns die Brauereien mit ihren gesteuerten Informationskampagnen weismachen wollen.
Es ist einfach, irgendein beliebiges Bier „anzuhübschen“, es Edel- oder Gourmetbier zu nennen und darauf zu bauen, dass der Kunde die neue Geschichte rund ums alte Produkt sprichwörtlich schluckt. Dauerhaft Absatzmärkte zu erschließen und gleichzeitig den Konsumenten über die tolle neue und tatsächlich authentische Craft-Beer-Bewegung zu informieren, wird meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen für die Brauwirtschaft, den Handel, die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche sein.
Problematisch: Der Begriff Craft Beer
Denn solange keine richtige, durchsetzungsstarke Plattform für Craft Beer in Deutschland existiert, ist der Begriff – so wie er in den USA verwendet und hier irreführenderweise adaptiert wird – im wahrsten Sinne des Wortes überflüssig. Erfolgreiche Brauereien in Deutschland kennen die Antworten auf die Frage des Konsumenten, der Kernzielgruppe. Derzeit ist es (leider) viel zu oft der Preis. Neue Biere treffen derzeit weitestgehend auf wehrlose Konsumenten. Und die fällen ihre Kaufentscheidung nach den Faktoren, die sie vergleichen können.
Es liegt also in den Händen der Braubetriebe als größte Wertschöpfer in der Prozesskette auf dem Weg zum Bier etwas zu ändern. Der Kunde wird nur etwas anfragen, das er kennt – und auch nur so wird sich eine große Nachfrage, ein Markt generieren. Wenn sich über die Brauereien nichts tut, dann braut der geneigte Bierfreund seinen Gerstensaft zukünftig eben selbst. Sollte sich dann darüber hinaus noch jemand finden, der für das Erzeugnis einen anständigen Preis bezahlt, dann kann sich daraus sogar ein Geschäft entwickeln. Ein hartes zwar, aber ein ehrliches, auch (aber vielleicht nicht nur) eines nach Reinheitsgeboten. Ich meinesteils freue mich schon auf die sicherlich noch zahlreich mutig, geschichts- und geschmacksstark daherkommenden Biere. Zum Wohl!