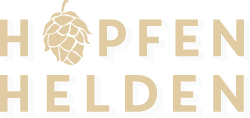Unter der Brücke geschehen ja eigentlich selten gute Dinge. Außer in Bermondsey, London: Dort braut Evin O’Riordain unter einer Eisenbahnbrücke in The Kernel Brewery eines der besten Biere der Stadt
Das könnte jetzt der Southeastern Train in Richtung Kent gewesen sein. Und das der in die Gegenrichtung, zur London Bridge. Man hört hier eigentlich jeden Zug, der auf der Ost-West-Strecke durch Südlondon fährt. Es wummert dann so ein bisschen von der Decke. The Kernel Brewery liegt nämlich direkt unter den Gleisen. Alle paar Minuten rumpelt es dumpf.
Vor zweieinhalb Jahren zog Evin O‘Riordain, Gründer jener Londoner Craft Brewery, die gut und gerne als der heißeste Scheiß der Stadt gelten darf, hier ein. Es war sein zweiter großer Schritt als Brauer. „Wir waren an unsere Grenzen als Mikrobrauer gekommen“, erzählt Toby Munn, O’Riordains erster Mitarbeiter und gelernter Brauer aus Sussex, „ und wollten uns vergrößern. Seit 2009 hatten wir ganz gutes Bier gemacht, das einigermaßen gut verkauft wurde.“
- Außen hui und innen auch:
- Gärtanks der Kernel Brewery.
- (Fotos: StP)
Man beachte das wunderschöne Beispiel britischen Understatements in dieser Aussage. Denn noch mal: The Kernel Brewery? Richtig. Heißer. Scheiß. Wer heute beschließt, das Bier in seinem Londoner Pub auf die Karte zu heben, hat Pech. Neue Kunden nehmen sie bei The Kernel nicht an, ihr gesamtes Bier wird ihnen so schon förmlich aus dem Tank gerissen. An Export ist kaum zu denken, es gibt ein paar handverlesene Sellingpoints im Rest-Königreich, ab und zu schaffen es ein paar Flaschen nach Schweden – mehr aber geht nicht. Zu große Nachfrage. Wenn samstags hier Tag der offenen Brauerei ist und im Taproom verkostet wird, muss man schon früh aufstehen. Ab 14 Uhr ist eigentlich immer längst wegen Überfüllung geschlossen. Gibt es einen Sondersud, wie neulich etwa das Lambic mit Kirschen, dann ist die Anzahl der Flaschen, die pro Kunde in der Brauerei direkt gekauft werden dürfen, begrenzt. Vier pro Kopf und Kehle, mehr nicht. Also: Diese Art heißer Scheiß meinen wir. Und das galt auch vor zwei Jahren. „Das Bier war damals schon Bombe und lief Hammer“ – so müsste man es eigentlich ausdrücken, wäre man nicht ein bescheidener britischer Brauer mit wilder Frisur, der an einem Freitagnachmittag in seiner Brauerei sitzt und Table Beer trinkt. Das perfekte Freitagnachmittagbier, findet Toby Munn. Über ihm rumpelt schon der nächste Zug.
Kein Bier wie das andere
Der Erfolg dieser eigentlich noch jungen, englischen Mikrobrauerei ist erstaunlich, besonders, wenn man bedenkt, dass The Kernel biervermarktungstechnisch so ziemlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Zumindest müssten das die Businessfuzzies in den Vertriebsabteilungen klassischer Brauereien so sehen: Ohne Businessplan und ohne Werbung gingen O’Riordain und seine Mitarbeiter hier ans Werk, mit relativ lahmen Etiketten und einem ganz großen Fehler: Bier von The Kernel war – und ist bis heute – absolut unkonstant. Das allergrößte No-Go der Industriebierbrauerei, wo man mit allergrößtem Bestreben bemüht ist, ein tausendprozentig konstantes Produkt zu machen, ein Bier, das immer, immer, immer gleich schmeckt. Bei The Kernel ist das nicht der Fall. Im Gegenteil: Bestellt man zum Burger auf dem Borough Market zwei Flaschen Kernel Pale Ale, kann es passieren, dass man zwei komplett unterschiedliche Pale Ales bekommt. Eines mit Mosaik-Hopfen, eines mit Citra und Simcoe. Oder so. Oder anders. Keine Charge schmeckt wie die andere – und das mit voller Absicht und aus Prinzip. Das muss man sich einmal vorstellen: Da kauft ein Wirt eine Palette Pale Ale im Oktober und verkauft die gut, seinen Gästen schmeckt’s. Dann kommt das Pale Ale im November – und schmeckt auf einmal völlig anders.
- Was man bei The Kernel mag:
- Dinosaurier, Design, Bikes.
- (Fotos: StP)
Toby Munn spielt mit einem Feuerzeug und nimmt noch mal einen Schluck Table Beer. Wie soll er das jetzt erklären ohne zu große Worte zu machen? Es soll ja nicht hochtrabend und schwülstig klingen. Aber – ach, er kommt nicht umhin, er muss da jetzt einfach Religionsunterricht- und Lovesong-Vokabular benutzen: Es gehe halt um „faith“, sagt er. Und um „trust“. „Unsere Kunden müssen Vertrauen in uns haben. Auch wenn sie nicht genau wissen, wie das nächste Bier schmecken wird, können sie sich darauf verlassen, dass es gut schmecken wird. Wir verkaufen nur, was wir selbst für gut halten. Das ist irgendwie eine Frage der Ehre.“
Außerdem, erklärt der Brauer weiter, sind die verschiedenen The Kernel Pale Ales ja nicht alle komplett verschiedene Biere. Vielmehr ist das Bier an sich immer gleich. Was variiert, ist der Hopfen. „Sicherlich prägt dessen Aroma den Geschmack eines Biere stark, aber ich finde, wenn man genau hinschmeckt, erkennt man das Bier darunter schon als konstant.“
Darum geht’s: Geschmack, Aroma, Flavour
Wir merken: The Kernel ist durchaus etwas für Fortgeschrittene. Eine Sache für Menschen, die sich mit dem Thema Geschmack, Aromen, Flavour einen Tick mehr beschäftigen als andere. Liegt daran, dass der Chef und Gründer der Londoner Craft Beer Brauerei selbst so ein Mensch ist: „Evin hat einen herausragenden Geschmackssinn und das zeichnet seine Biere aus“, sagt Toby. Der technische Hintergrund mag ihm fehlen, der gebürtige Ire hat bis vor fünf Jahren noch im Cheese-Business für Neal’s Yard Dairy, einen Feinkost-Käsehändler, gearbeitete. Aber das mache er durch sein immenses Geschmacksverständnis wett, sagt Toby. Eigentlich sei es sogar so, dass er als ausgebildeter Brauer viel von seinem Boss, dem Brau-Autodidakten, gelernt habe. „Er hat mir beigebracht, die einzelnen Aromen des Bieres auseinander zu klamüsern und genauer zu erkennen, was ich mag und was nicht. So etwas lernt man nicht wirklich in der Brauerausbildung. Evin kann unheimlich gut über Geschmack reden ohne dabei ins phrasenhafte Sommerliersgeschwurbel abzudriften. Und er macht allen seinen Mitarbeitern immer Mut, eine Meinung zum Geschmack unserer Biere zu haben und auszusprechen.“
- Hier fängt gutes Bier an…
- …und hier geht es weiter.
- Dabei von Anfang bis Ende: Toby Munn. (Fotos: StP)
12 Leute sind sie mittlerweile in drei langestreckten Hallen unter den Gleisen in Bermondsay, South London. Sudhaus, Abfüllanlage, Fasslager und Bottleshop fließen ineinander, an den Wänden hängen Rennräder und ein handgemaltes Dinosaurier-Bestimmungs-Plakat. Das ist von Kai, Evins Sohn. Pro Woche brauen sie hier 13.000 Liter Bier ein. Zum Team gehören vier Mädels. Es gibt drei gelernte Brauer, der Rest der Mannschaft sind Homebrewer, Weinfachleute, Ex-Käse-Kollegen. Und jeder hat abwechselnd beim Brauen mal den Hut auf, erzählt Stephanie Poltinger, eine Weihenstephan-Absolventin. Wer braut, entscheidet, wie das Bier schmecken wird.
„Wir sind immer noch dabei, das Beste zu finden und experimentieren gern und viel“, sagt Toby Mann. Und nach noch einem Schluck Table Beer lässt er das mit dem Understatement dann doch noch mal sein und erzählt die Werde-Geschichte der Brauerei zu Ende: „Wir sind also sehr klein gestartet, hatten aber immer schon riesige Ansprüche. Evin ist jemand, der sehr aufs Detail achtet. Und nachdem unser Ausstoß anfangs relativ gering war, war die Nachfrage eigentlich immer groß genug. Wir mussten nie raus und Klinken putzen um unser Bier zu verkaufen. Wir konnten uns immer voll auf unser Bier konzentrieren.“ Pause für ein bisschen Zuggerumpel. „Irgendwann kamen wir zu dem Punkt, an dem wir mit dem Equipment, das wir hatten, nicht weiter kamen, nicht besser werden konnten. Wir mussten also auf das nächste Level und uns vergrößern.“ Das, schiebt er dann aber schnell hinterher, reicht nun auch fürs Erste. Sie planen nicht, sich weiter zu vergrößern. Nur immer noch besser zu werden, daran arbeiten sie weiter.

Ende vom Lied: Bier vom Ex-Cheese-Man in minimalistisch designter Flasche und der Hopfung du jour. (Foto:StP)